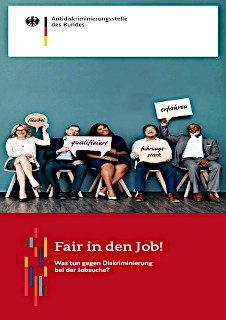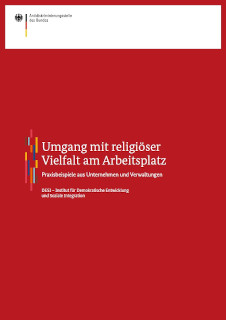Religion / Weltanschauung
Im Jahr 2023 bezogen sich sieben Prozent der Beratungsanfragen
an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf das Merkmal Religion
und Weltanschauung.
Bei Diskriminierung wegen der Religion spielt die Sichtbarkeit der Religionszugehörigkeit eine große Rolle. Diskriminierungsformen unterscheiden sich dabei je nach Glaubenszugehörigkeit: So berichten Jüd*innen vermehrt von Anfeindungen oder Beleidigungen in Alltagssituationen, während insbesondere kopftuchtragende muslimische Frauen Diskriminierung bei der Jobsuche erleben.
Alle anerkannten Religionen sowie konfessionslose Menschen sind grundsätzlich vor Benachteiligungen geschützt. Kirchliche Arbeitgeber können jedoch unter bestimmten Bedingungen im Rahmen des sogenannten Kirchenprivilegs besondere Anforderungen bezüglich der Religion an ihre Beschäftigten stellen. Auch zu diesem Thema erreichen die Antidiskriminierungsstelle des Bundes immer wieder Anfragen, z. B. wenn eine konfessionslose Person eine Stelle in einem christlichen Krankenhaus nicht erhält. Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) der vergangenen Jahre haben dieses Privileg präzisiert: Ein loyales Verhalten im Sinne des kirchlichen Selbstverständnisses kann demnach nicht pauschal für alle Tätigkeiten gefordert werden.
Darüber hinaus verbietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auch Diskriminierungen aufgrund einer bestimmten Weltanschauung. Darunter fallen laut der Rechtsprechung allerdings nur ganzheitliche Einstellungen, die das gesamte Weltbild einer Person prägen – Parteizugehörigkeit oder Überzeugungen zu einzelnen gesellschaftlichen Themen gehören beispielsweise nicht dazu. Der Schutz der Weltanschauung durch das AGG beschränkt sich zudem auf das Arbeitsleben.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bietet eine Reihe von Informationen und praxisorientierten Unterstützungsmaterialien zum Thema.
FAQs zum Thema Religion/Weltanschauung
Fragen und Antworten
-
In Artikel 4 des Grundgesetzes ist die freie Religionsausübung aller Bürger*innen festgeschrieben. Darüber hinaus sind Menschen durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) im Arbeitsleben vor Diskriminierungen wegen der Religion oder Weltanschauung geschützt (§ 1 AGG). Auch bei Alltagsgeschäften sind Diskriminierungen wegen der Religion verboten, zum Beispiel bei der Wohnungssuche.
-
Zum Jahresende 2023 lebten in Deutschland nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 84,7 Millionen Menschen.
Religion / Gemeinschaft in Mio. in Prozent Katholische Kirche 21,6 26,0 Evangelische Landeskirchen 19,2 23,1 Freikirchen / Sondergemeinschaften 1,9 2,3 Orthodoxe / orientalische Kirchen 1,6 1,9 Jüdische Gemeinden 0,09 0,1 Islam 5,5 6,6 Hindus / Hinduisten 0,1 0,1 Yeziden 0,1 0,1 Buddhisten 0,3 0,4 Organisierte Konfessionsfreie 0,4 0,5 Neue Religionen / Esoterik 0,9 1,1 Konfessionslos / keine Zuordnung 31,5 37,9 Quelle: REMID – Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e.V. (2023)
-
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet Diskriminierungen wegen der Religion oder Weltanschauung in Beschäftigung und Beruf (§ 2 AGG). Der Schutz erstreckt sich auf das gesamte Arbeitsleben: vom Zugang zu einem Beruf über das Beschäftigungsverhältnis bis hin zur Kündigung.
Über die Frage, inwieweit Religionsgemeinschaften als Arbeitgeber*in bei der Personalauswahl auf einer bestimmten Religionszugehörigkeit beharren dürfen, wurde bereits mehrfach vor Gericht gestritten. Grundsätzlich gilt: Eine Benachteiligung wegen der Religion in Bewerbungsverfahren ist gemäß § 7 Absatz 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verboten. Betroffene können in solchen Fällen Schadensersatz- und Entschädigungsforderungen nach dem AGG geltend machen.
Eine Ausnahme hiervon findet sich jedoch im § 9 AGG für Religionsgemeinschaften, wonach Benachteiligungen im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften gerechtfertigt und zulässig sein können.
Anfang 2019 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) allerdings dieses Selbstbestimmungsrecht der christlichen Kirchen eingeschränkt. Das BAG beurteilte die Kündigung eines wiederverheirateten Chefarztes durch den katholischen Träger eines Krankenhauses als rechtswidrig. Kirchliche Arbeitgeber müssen demzufolge in Zukunft Loyalitätspflichten genau prüfen und sorgfältig begründen. Bereits 2018 hatte der Europäischen Gerichtshofes (EuGH) festgelegt, dass ein loyales Verhalten im Einzelfall anhand der konkreten Tätigkeit begründet werden muss. Seither gilt: Nur wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung nach der Art der Tätigkeiten oder den Umständen ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt, kann eine Ungleichbehandlung aufgrund der Vorschrift des § 9 Absatz 1 AGG erlaubt sein. Eine Bewerbung darf wegen der fehlenden Religionszugehörigkeit abgelehnt werden, wenn die berufliche Position (wie z. B. bei der Leitung einer Religionsgemeinde) mit einem Beitrag zu deren Verkündigungsauftrag oder Notwendigkeit verbunden ist, für eine glaubwürdige Vertretung der Kirche oder Organisation nach außen zu sorgen.
-
Die Beratung der Antidiskriminierungsstelle und zahlreiche Studien zeigen, dass Muslim*innen häufig von Diskriminierung betroffen sind. Vor allem Frauen mit Kopftuch wenden sich wegen Ungleichbehandlungen im Arbeitsleben an unser Beratungsteam.
Dem Thema "Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit im Kontext Arbeitsleben" widmet sich jeweils eine rechtswissenschaftliche und eine sozialwissenschaftliche Studie.
Menschen jüdischen Glaubens erleben ebenfalls häufig Diskriminierungen, z. B. in Form von Mobbing am Arbeitsplatz oder auch wenn sie mit Kippa nicht in ein Restaurant gelassen werden. Aber auch Menschen, die anderen Religionen angehören, nicht konfessionell gebunden sind und Menschen, die eine Weltanschauung wie beispielweise den Humanismus vertreten, können Diskriminierung erfahren.
Menschen werden insbesondere dann häufig diskriminiert, wenn ihre Religionszugehörigkeit sichtbar wird, z. B. durch das Tragen bestimmter Kleidungsstücke, wie z. B. einer Kippa oder eines Kopftuchs, oder durch die Teilnahme an religiösen Festen. Mitunter reicht aber bereits der Name für Diskriminierungen aus. An unsere Beratung hat sich beispielsweise eine Person gewandt, die wegen des Vornamens „David“ antisemitisch beleidigt wurde.
-
In Deutschland leben etwa 5,3 bis 5,6 Millionen Musliminnen und Muslime (Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Neben den christlichen Kirchen stellen sie die zweitgrößte religiöse Gruppierung in Deutschland. Angehörige des muslimischen Glaubens sind in Deutschland und Europa zunehmend von Ausgrenzung, Diskriminierung und rassistischer Gewalt betroffen. Eine sehr große Zahl der Anfragen an unsere Beratung stammt von Frauen, die wegen ihres muslimischen Kopftuchs einen Arbeitsplatz nicht bekommen oder bei der Wohnungssuche abgelehnt werden.
Darüber hinaus zeigen Untersuchungen im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass muslimische Schüler*innen bei gleicher Leistung weniger häufig eine Empfehlung für den Besuch eines Gymnasiums erhalten und überdurchschnittlich oft eine Förderschule besuchen. (Quelle: Forschungsprojekt zum Zweiten Gemeinsamen Bericht zum Thema "Diskriminierung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben"). Im Berufsleben wird muslimischen Menschen ein unterdurchschnittliches Qualifikationsniveau und geringe Leistungsfähigkeit unterstellt. Außerdem wird oft angenommen, dass Kolleg*innen oder Kund*innen negativ auf muslimische Mitarbeitende reagieren könnten.
-
Schätzungsweise 30 Prozent der in Deutschland lebenden Musliminnen tragen ein Kopftuch. Das ergab eine Untersuchung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2020.
In den vergangenen Jahren gab es vermehrt Debatten über und Rechtsprechung zum sichtbaren Tragen religiöser Symbole am Arbeitsplatz. In Deutschland und auf europäischer Ebene stand hier zumeist das Kopftuch muslimischer Frauen im Mittelpunkt.
Gerade muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, erleben in Deutschland überdurchschnittlich häufig Diskriminierung im Arbeitsleben. Dabei werden sie z. B. von ihren Arbeitgeber*innen aufgefordert, ihr Kopftuch abzunehmen und viele werden gar nicht erst zum Bewerbungsgespräch eingeladen.
Häufig werden solche Benachteiligungen mit dem Wunsch nach Neutralität oder Kundenwünschen begründet. Verbote von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen bedürfen im Arbeitsleben allerdings einer guten Begründung, da sie direkt in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen.
Grundsätzlich darf in Deutschland jeder Mensch die eigene Religion frei ausleben - auch am Arbeitsplatz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet darüber hinaus Diskriminierungen aufgrund der Religion oder Weltanschauung im Arbeitsleben. Das bedeutet, dass Arbeitgeber*innen weder bei der Bewerbung noch im Arbeitsalltag einzelne Personen wegen ihres Glaubens benachteiligen dürfen.
Es gibt aber Ausnahmen und Regelungen, die ein Verbot religiöser Symbole am Arbeitsplatz durch den/die Arbeitgeber*in rechtfertigen. Wenn es so sein sollte, dass die Arbeit mit Maschinen durch das Tragen eines Kopftuchs oder einer Kette zu gefährlich sein kann, wäre ein Verbot aus sachlichen Gründen also zulässig. Zusätzlich gibt es weitere Ausnahmen, die sich aber bei privatwirtschaftlichen, staatlichen und kirchlichen Arbeitgeber*innen unterscheiden.
-
Antisemitismus wird in Deutschland vor allem seit dem 7. Oktober 2023 in allen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar. Dem Jahresbericht der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) zufolge habe es zwischen dem 7. Oktober und dem Jahresende rechnerisch 32 Vorfälle pro Tag gegeben. 2022 seien es sieben pro Tag gewesen. Das Kriegsgeschehen in Israel und Gaza habe "einen Anlass für Mobilisierungen und antisemitische Vorfälle" gegeben. In 52 Prozent aller Vorfälle habe es sich um israelbezogenen Antisemitismus gehandelt mit Ausagen, die sich gegen den jüdischen Staat Israel richteten.
Polizeilich wurden im Jahr 2023 5164 antisemitische Übergriffe erfasst. Der massive Zuwachs (2022: 2.641, davon 88 Gewalttaten) ist vor allem auf den Anstieg nach dem 7. Oktober 2023 zurückzuführen. Aber auch mit niedrigschwelligen Formen von Antisemitismus können Jüd*innen konfrontiert werden: in Form von Mobbing durch Nachbar*innen, Schikanen in der Schule oder antisemitischen Äußerungen in den sozialen Medien. An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben sich beispielsweise Arbeitnehmer*innen gewandt, die sich in Arbeitsumfeld wegen ihres jüdischen Glaubens gemobbt fühlten.
-
Unter dem juristischen Begriff der Weltanschauung ist ein für die Lebensführung eines Menschen verbindliches und identitätsstiftendes Verständnis des menschlichen Lebens und der Welt zu verstehen, welches von einer relevanten Zahl anderer geteilt wird. Es muss sich grundsätzlich um eine religionsähnliche Überzeugung handeln, die sich aber auf das Diesseits bezieht. Die Gerichte verstehen unter einer Weltanschauung ein subjektiv verbindliches Gedankensystem, das sich mit Fragen nach dem Sinnganzen der Welt und insbesondere des Lebens der Menschen in dieser Welt befasst, und das zu sinnentsprechenden Werturteilen führt (bspw. BVerwG, Urteil vom 19. Februar 1992 – 6 C 5/91). Demnach stellen Überzeugungen zu einzelnen Teilaspekten des Lebens keine Weltanschauung dar. Entsprechend werden rein politische Überzeugungen nicht als Weltanschauung anerkannt (VG Berlin, Urteil vom 18. April 2018 – 28 K 6.14) ebenso wenig wie die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft (AG München, Urteil vom 18. Oktober 2012 – 423 C 14869/12). Gesamtgesellschaftliche Theorien und Philosophien wie der Marxismus oder anthroposophischen Lehren werden dagegen als Weltanschauungen eingeordnet.
-
Das Grundgesetz schützt auch das Recht eines Menschen, keiner Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft anzugehören. Dies wird als negative Religions- und Weltanschauungsfreiheit bezeichnet. Daraus folgt, dass auch das AGG bei einer individuellen Ablehnung jeden Sinnzusammenhangs, sei er religiös oder weltanschaulich-säkular begründet, einen Schutz vor Diskriminierung wegen der Religion oder Weltanschauung gewährleistet. Deshalb darf ein Arbeitgeber eine Bewerbung grundsätzlich nicht deshalb ablehnen, weil die Person nicht Mitglied einer bestimmten Religionsgemeinschaft ist.
FAQs zum Thema Kopftuch am Arbeitsplatz
Fragen und Antworten
-
In den vergangenen Jahren gab es vermehrt Debatten und Gerichtsurteile zum sichtbaren Tragen religiöser Symbole am Arbeitsplatz. In Deutschland und auf europäischer Ebene stand hier zumeist das Kopftuch muslimischer Frauen im Mittelpunkt.
Gerade muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, erleben in Deutschland überdurchschnittlich häufig Diskriminierung im Arbeitsleben. Verschiedene Untersuchungen sowie die Beratungsarbeit der Antidiskriminierungsstelle zeigen: Immer wieder werden Frauen von ihren Arbeitgeber*innen aufgefordert, ihr Kopftuch abzunehmen, viele werden gar nicht erst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.
Häufig werden solche Benachteiligungen mit dem Wunsch nach Neutralität oder Kund*innenwünschen begründet. Verbote von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen bedürfen im Arbeitsleben allerdings einer guten Begründung, da sie die Grundrechte der Betroffenen beeinträchtigen.Auf rechtlicher Ebene geht es dabei im Kern darum, abzuwägen, welche Rechte im Zweifelsfall schwerer wiegen: Das Grundrecht auf Religionsfreiheit und das Diskriminierungsverbot oder das Recht und ggf. die Pflicht von Arbeitgeber*innen in der Öffentlichkeit religiös neutral aufzutreten.
-
Nein. Grundsätzlich darf in Deutschland jeder Mensch die eigene Religion frei ausleben – auch am Arbeitsplatz. Dies ergibt sich bereits aus dem Grundrecht auf Religionsfreiheit (Art. 4 des Grundgesetzes). Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet darüber hinaus Diskriminierungen aufgrund der Religion oder Weltanschauung im Arbeitsleben. Das bedeutet, dass Arbeitgeber*innen weder bei der Bewerbung noch im Arbeitsalltag einzelne Personen wegen ihres Glaubens benachteiligen und die Ausübung ihrer Religion behindern dürfen..
Es gibt aber Ausnahmen und Regelungen, die ein Verbot religiöser Symbole am Arbeitsplatz durch den/die Arbeitgeber*in rechtfertigen. Zum Beispiel kann das Tragen eines Kopftuchs oder einer Kette bei der Arbeit mit Maschinen gefährlich sein. Ein Verbot aus sogenannten sachlichen Gründen kann also zulässig sein. Zusätzlich gibt es weitere Ausnahmen, die sich aber bei privatwirtschaftlichen, staatlichen und kirchlichen Arbeitgebern unterscheiden. -
Es ist grundsätzlich unzulässig, ausschließlich religiöse Symbole am Arbeitsplatz zu verbieten. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil von 2017 aber klargestellt, dass Arbeitgeber*innen das Recht haben, nach außen hin neutral aufzutreten. Entsprechend dürfen sie auch von ihren Beschäftigten ein neutrales Auftreten einfordern (Urteil vom 14. März 2017, C-157/15).
Aber: Diesen Neutralitätsanspruch können Arbeitgeber nur für Tätigkeiten erheben, die im weiteren Sinne für das Unternehmen repräsentativ sind. Vor allem muss der Neutralitätsanspruch in gleichem Maße für politische oder weltanschauliche Überzeugungen gelten und kann sich nicht nur auf die Religion beziehen.
Betriebliche Neutralität bedarf außerdem einer klaren betriebsinternen Regelung, die sich auf den gesamten Betrieb bezieht und im Betriebsalltag konsequent durchgesetzt wird. Neutralitätsregelungen, die mittelbar nur einzelne Religionen betreffen oder nur zum Zweck eingeführt wurden, einzelnen Beschäftigten das Tragen religiöser Symbole zu verbieten, sind unzulässig.
Dabei hängt die Frage nach der Wirksamkeit eines Kopftuchverbots jedoch immer von den Umständen des Einzelfalls ab und beschäftigt somit auch die Gerichte immer wieder aufs Neue. Erst im Januar 2019 richtete das Bundesarbeitsgericht im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens mehrere Fragen zur Wirksamkeit eines betrieblichen Kopftuchverbots an den Europäischen Gerichtshof (Vorlagebeschluss vom 30. Januar 2019, Aktenzeichen: 10 AZR 299/18 (A)). Es gilt abzuwarten, wie sich der Gerichtshof hierzu positionieren wird.
Der EuGH hat sich am 15.07.2021 in einem Urteil mit Fragen des BAG (C-341/19) und des Arbeitsgerichts Hamburg (C-804/18) befasst. Die Richter*innen in Luxemburg führten aus, dass ein allgemeines undifferenziertes Verbot von Zeichen, die auf eine Religion oder Weltanschauung schließen lassen, keine unmittelbare Diskriminierung gegenüber der kopftuchtragenden Klägerin darstelle. Denn das Verbot treffe alle Religionen und Weltanschauungen gleichermaßen.
Eine mittelbare Diskriminierung verneinte der EuGH ebenfalls. Sofern der Wille objektiv neutral aufzutreten, auf ein tatsächliches Bedürfnis des Arbeitgebers zurückgehe, sei ein solches Verbot von der unternehmerischen Freiheit gem. Art. 16 EU-GRCH gedeckt und somit gerechtfertigt. Das Verbot muss dabei jedoch auf das tatsächlich Notwendige beschränkt werden. Eine Reduzierung auf großflächige oder auffällige Zeichen, sei unzulässig. (So auch EuGH 13.10.2022 AZ: C-344/20 in Bezug auf eine Gemeindeverwaltung in Belgien.
Darüber hinaus dürfen Neutralitätsregelungen nicht zu Benachteiligungen im Bewerbungsprozess führen. Allein weil eine Bewerberin beispielsweise auf einem Bewerbungsfoto oder im Vorstellungsgespräch ein Kopftuch trägt, darf ihre Bewerbung nicht abgelehnt werden. Arbeitgeber*innen können erst dann Konsequenzen aufgrund einer Neutralitätsregelung ziehen, wenn Bewerber*innen bzw. Beschäftigte nicht bereit sind, auf den sichtbaren religiösen Ausdruck am Arbeitsplatz zu verzichten. -
Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen hat der Staat nicht die Freiheit, sondern die Pflicht, neutral aufzutreten. Das Neutralitätsgebot ist im Grundgesetz festgeschrieben und steht hier dem Recht auf Religionsfreiheit gegenüber. In Deutschland muss also im Einzelfall geklärt werden, in welchen staatlichen Bereichen ein Verbot religiöser Symbole zulässig bzw. geboten ist.
Zwar müssen sich alle Beamt*innen grundsätzlich religiös, politisch und weltanschaulich neutral verhalten, ein generelles Verbot religiöser Symbole für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes kann aus dem Neutralitätsgebot jedoch nicht abgeleitet werden. Wenn Beschäftigten des öffentlichen Dienstes das Tragen religiöser Symbole im Dienst verboten werden soll, müssen zum Schutz der grundgesetzlichen Religionsfreiheit auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern konkrete Gesetze erlassen werden, die ein Verbot religiöser Symbole im öffentlichen Dienst begründen.Auch der EuGH hat den Mitgliedstaaten und Bundesländern einen Wertungsspielraum bezüglich der Neutralität von staatlichen Stellen zugestanden, um deren Ansatz von Vielfalt im Inneren des öffentlichen Dienstes Rechnung zu tragen. Ein Verwaltungsumfeld der völligen Neutralität kann somit ebenso zulässig sein, wie eine Einschränkung, die nur bei Publikumsverkehr greift oder eine generelle allgemeine Erlaubnis von religiösen und weltanschaulichen Zeichen (EuGH Urteil vom 28.11.2023, Aktenzeichen: C-148/22 bezüglich eines Falles aus Belgien).
Zudem muss eine Arbeitssituation vorliegen, in der die Wahrung staatlicher Neutralität stärker als die Religionsfreiheit zu gewichten ist. In diesem Zusammenhang steht die Frage im Vordergrund, ob durch sichtbare religiöse Symbole das Vertrauen der Bürger*innen in den Staat beschädigt werden könnte. Bei sehr wichtigen bzw. hoheitlichen Aufgaben des Staates, z. B. bei der Polizei oder in der Justiz, ist der Neutralitätsanspruch deshalb besonders hoch.
In einem Fall in Hessen hat der Verwaltungsgerichtshof Kassel die Beschwerde einer muslimischen Referendarin abgelehnt, nachdem ihr das Tragen eines Kopftuchs in bestimmten Tätigkeiten des Referendariats untersagt wurde (Beschluss vom 23. Mai 2017, Aktenzeichen: 1 B 1056/17). Die Untersagung sei gerechtfertigt, wenn sie richterliche oder staatsanwaltschaftliche Aufgaben übernehme und dabei als Repräsentantin der Justiz wahrgenommen werde. Das Gericht entschied hier, dass die Religionsfreiheit der Referendarin hinter der Neutralität des Staates zurücktreten müsse, insbesondere weil die zugrundeliegende Regelung im Hessischen Beamtengesetzbuch eine ausreichende gesetzliche Grundlage sei. Darüber hinaus bewertete das Gericht die Auswirkungen auf die Ausbildung der Referendarin als zumutbar, weil sich das Verbot nur auf einen kleinen Teil der Ausbildung beziehe. Eine gegen die Entscheidung des Gerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde der Referendarin hat das Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen und das Neutralitätsgebot des Staates betont (Beschluss vom 14. Januar 2020, Aktenzeichen: 2 BvR 1333/17).
In einem ähnlichen Fall hingegen gab das Verwaltungsgericht Augsburg einer Rechtsreferendarin recht, die geklagt hatte, weil sie ebenfalls bestimmte Tätigkeiten während ihres Referendariats nicht wahrnehmen durfte (Urteil vom 20. Juni 2016, Aktenzeichen: 2 Au K 15.457). Hier fehlte allerdings nach Ansicht des Gerichts in Bayern bereits die erforderliche gesetzliche Grundlage, weshalb das Verbot als unzulässig eingestuft wurde. Das Urteil wurde jedoch mittlerweile aus verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben; (BayVGH vom 07.03.2018, Aktenzeichen: 3 BV 16.2040). Das BVerwG bestätigte am 12.11.2020 (Aktenzeichen: 2 C 5/19) das erstinstanzliche Urteil und rügte die damals fehlende Gesetzesgrundlage.
In der Zwischenzeit hat der Bayerische Landtag ein neues Richter- und Staatsanwaltschaftsgesetz erlassen, das religiöse oder weltanschaulich geprägte Kleidung im Gerichtssaal verbietet. Dieses Gesetz wurde im Zuge einer Popularklage vom Bayrischen Verfassungsgerichtshof mit der Begründung bestätigt, dass die Wahrung der Neutralität der Justiz und das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Gerichte verfassungsrechtlich legitime Ziele verfolge (Urteil vom 14.03.2019 Vf. 3-VII-18).
-
Am häufigsten wurde in den vergangenen Jahren in Deutschland über das Tragen religiöser Symbole im Schuldienst gestritten, insbesondere bei muslimischen Lehrerinnen, die ein Kopftuch tragen. In einigen Bundesländern wurden Gesetze verabschiedet, die Lehrkräften das Tragen religiöser Symbole verbieten. Die allermeisten Regelungen begründen dies damit, dass religiöse Kleidung die Neutralität des Staates gegenüber Schüler*innen und Eltern sowie den religiösen Schulfrieden gefährden könnte. Einige Bundesländer haben zudem eine Privilegierung christlich-abendländischer Werte verankert.
In einem Urteil von 2015 stellte das Bundesverfassungsgericht jedoch klar: Pauschale Verbote, die Lehrkräften das Tragen religiöser Symbole im Schuldienst grundsätzlich verbieten, sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar (Urteil vom 27.01.2015, Aktenzeichen 1 BvR 471/10 und 1 BvR 1181/10). Der Neutralitätsanspruch im Rahmen des staatlichen Erziehungsauftrags tritt also zunächst hinter die Religionsfreiheit von Lehrkräften zurück.
Ein Verbot ist nur in konkreten Fällen begründet, wenn es an einer Schule oder in einem Schulbezirk zu religiösen Konflikten gekommen ist, von denen eine tatsächliche Gefährdung der staatlichen Neutralität oder Störung des Schulfriedens ausgehen. Darüber hinaus sollen solche Verbote zeitlich begrenzt sein und dürfen einzelne Religionen nicht privilegieren.Auch das Bundesarbeitsgericht bestätigte in einem Fall, in dem eine Bewerberin erfolgreich wegen eines Verstoßes gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf Zahlung einer Entschädigung geklagt hatte, dass muslimische Lehrerinnen nicht unter pauschaler Berufung auf eine abstrakte Gefährdung für den Schulfrieden und der staatlichen Neutralität abgelehnt werden dürften (Urteil vom 27.08.2020, Aktenzeichen: 8 AZR 62/19).
Das Landesarbeitsgericht Berlin hatte zuvor geurteilt, dass ein Verbot des Kopftuchs zwar durch den EuGH als zulässig erachtet wird, jedoch muss sich die Rechtfertigung nach § 8 AGG an verfassungsrechtlichen Vorgaben messen. Diesen Vorgaben genügte die Argumentation des Landes Berlin aufgrund fehlender Einzelfallbezogenheit und einer zu abstrakten Prohibition nicht.
Das Bundesverfassungsgericht lehnte die darauf bezogene Verfassungsbeschwerde ab (BVerfG Beschluss vom 17.01.2023, Aktenzeichen: 1 BvR 1661/21).
Dessen ungeachtet haben einige Bundesländer ihre Gesetzgebung nicht verändert. In Berlin, Bremen und Hessen haben die jeweiligen Neutralitätsgesetze bisher weiter Bestand. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und im Saarland bleibt darüber hinaus die Privilegierung christlich-abendländischer Werte bestehen. -
Nach § 9 AGG haben Religionsgemeinschaften, die als Arbeitgeber z.B. ein Krankenhaus oder eine Schule betreiben, besondere Rechte. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit zwei Grundsatzentscheidungen das Selbstbestimmungsrecht der kirchlichen Arbeitgeber deutlich eingeschränkt. Nach dem EuGH-Urteil aus dem Frühjahr 2018 können diese von ihren Beschäftigten nicht mehr pauschal eine bestimmte Religionszugehörigkeit verlangen. Wenn eine solche verlangt wird, muss dieses Erfordernis gerichtsfest begründet werden. Es kommt im Einzelfall darauf an, ob eine bestimmte berufliche Tätigkeit wesentlich mit der Ausübung der Religion bzw. Weltanschauung zusammenhängt.
Im September 2018 hat der EuGH mit dem sogenannten Chefarzturteil zudem entschieden, dass ein loyales Verhalten im Sinne des kirchlichen Selbstverständnisses (§ 9 Abs. 2 AGG) nicht pauschal für alle Tätigkeiten gefordert werden darf. Es ist vielmehr im Einzelfall anhand der konkreten Tätigkeit zu begründen und es unterliegt der gerichtlichen Kontrolle (Urteil vom 11. September 2018, C-68/17). Das Urteil bezieht sich auf den Rechtsstreit eines Chefarztes an einem katholischen Krankenhaus, dem gekündigt worden war, weil er nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau, mit der er nach katholischem Ritus verheiratet war, erneut standesamtlich geheiratet hatte, ohne dass seine erste Ehe für nichtig erklärt worden wäre.
-
Für Arbeitgeber*innen kann es gute Gründe geben, sich aktiv mit der religiösen Vielfalt im eigenen Unternehmen zu beschäftigen. Zum einen kann ein offener und wertschätzender Umgang mit religiöser Vielfalt das Betriebsklima verbessern, die eigene Attraktivität als Arbeitgeber*in steigern und so gewinnbringend für das Unternehmen genutzt werden. Zum anderen können mögliche Konflikte vermieden und Diskriminierungsrisiken verringert werden.
Welche Möglichkeiten es für Arbeitgeber*innen gibt, einen sensiblen Umgang mit religiöser Vielfalt zu fördern und welche vorbildlichen Praxisbeispiele es bereits gibt, beantwortet der Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: „Religiöse Vielfalt am Arbeitsplatz. Grundlagen und Praxisbeispiele“.