Kleine Pause Podcast „Kleine Pause“
Eine Lehrerin aus Köln wirft einen diversitätssensiblen, diskriminierungskritischen und möglichst multiperspektivischen Blick auf das deutsche Schulsystem. In ihrem Podcast „Kleine Pause“ und auf ihrem Instagram-Kanal spricht sie darüber mit unterschiedlichen Gästen, gibt Impulse und versucht, Brücken zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Der Podcast startete 2021 als Teamprojekt. Mittlerweile führt sie ihn in Eigenregie weiter.
- Schulform:
- Berufsschule, Förderschule, Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Grundschule, Gymnasium, Oberschule, Sekundarstufe
- Handlungsfelder:
- Beiträge zur öffentlichen Diskussion, Social Media als Kommunikationsplattform
- Angaben zum Träger des Praxisbeispiels:
- Privates Engagement einer Lehrerin
- Bundesland:
- Nordrhein-Westfalen
- Diskriminierungskategorie:
- Alle Diskriminierungskategorien
- Durchführung:
- seit 2021
Kontakt
Nicole Schweiß, Gastgeberin des Podcasts E-Mail: kleinepausepodcast@gmail.com
Durchführende Organisation
Der Podcast „Kleine Pause“ beruht auf dem privaten Engagement von Nicole Schweiß, einer Lehrerin eines Kölner Gymnasiums. Sie hat den Podcast in den letzten Jahren mit einer Kollegin aufgebaut. Sie haben diese Initiative in der Schule zwar transparent kommuniziert, es handelt sich jedoch nicht um eine Aktion der Schule. Die Inhalte des Podcasts verantwortet sie selbst.
Unabhängig von diesem Engagement leitet Nicole Schweiß eine diskriminierungskritische Arbeitsgemeinschaft (AG).
Am Reflexionsgespräch Beteiligte
Das Reflexionsgespräch wurde mit Nicole Schweiß geführt.
Ausgangslage und Motivation
Der Beginn
Christina Schreck und Nicole Schweiß sind gerne Lehrerinnen. Aber sie sind in einem Dilemma. Ihr starker Gerechtigkeitssinn bricht sich immer wieder an dem System Schule, das – wie viele Institutionen dieser Gesellschaft – von machtvollen und auch diskriminierenden Strukturen geprägt ist.
Sie verfolgten auf der einen Seite die kritischen Stimmen zu Diskriminierung und speziell Rassismus, wie sie zum Beispiel im Rahmen der Black-Lives-Matter-Bewegung laut wurden. Gleichzeitig nahmen sie wahr, wie wenig Berührung das System Schule mit diesen Diskursen hat. So entstand die Idee zu einem Podcast im Gesprächsformat, der mehr Perspektivenvielfalt auf Schule sichtbar machen soll. Sie wollten inspirierende Menschen einladen, um mit ihnen über Schule zu sprechen und so auch die Schule selbst einem Realitätscheck zu unterziehen.
Ziele
Sie betrachteten es auch als ihre Verantwortung, aus einer relativ privilegierten Situation heraus aktiv zu werden. Gerade aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position sahen sie die Chance, dass ihnen Menschen zuhören würden. Ging es ihnen dabei zunächst um den Nahraum ihrer Schule und der Schulen im Umfeld, so reifte bald die Idee, das Projekt größer zu denken und die Reichweite auszubauen.
Maßnahmenbeschreibung
Der Podcast
Die Idee des Podcasts ist einfach: Nicole Schweiß lädt circa alle drei Wochen Gäste ein, die im weitesten Sinne mit Diskriminierungskritik zu tun haben. Es können Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft wie der politischen Bildung oder der Kultur-, Kunst- und Literaturszene sein. Ganz bewusst sucht sie nach Akteur*innen, die nicht besonders schulnah sind. Da aber alle Menschen in unserer Gesellschaft eine eigene Schulerfahrung haben, können auch alle etwas zum Thema Schule sagen.
Der Ablauf ist jedes Mal ähnlich: Die Gesprächspartner*innen stellen sich vor und machen ihre gesellschaftliche Positionierung transparent. Als Einstieg fungiert die Frage nach dem eigenen Bezug zur Schule. Dieser muss explizit nicht biografisch sein. Die Gesprächspartner*innen können zu ihrem eigenen Schutz frei wählen, wie persönlich sie werden möchten. Daran schließt sich ein offenes Gespräch an. Die Moderatorin steuert lediglich, indem sie ab und zu wieder einen stärkeren Bezug zur Schule herstellt. Im besten Fall kommt es zu einem gemeinsamen Nachdenken.
Social Media
„Kleine Pause“ nutzt neben dem oben beschriebenen Format auch Instagram. Diesen Kanal sieht Nicole Schweiß zum einen als Werbung für den Podcast. Zum anderen ist Instagram aber auch interaktiver nutzbar. Zwar gibt es auch bei dem Podcast eine Kommentarfunktion, diese wird aber wenig genutzt. Bei den Nutzer*innen von Podcast und Instagram gibt es eine große Schnittmenge.
Verstetigung und Verankerung
Das Projekt ist wenig institutionalisiert und beruht auf außerschulischem Engagement. Es ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Die Betreiberin hat sich zudem weiter vernetzt.
Positive Effekte aus Sicht der Akteur*innen
Reichweite
Der Podcast hat aktuell circa 700 Abonnent*innen, die auch regelmäßig dem Podcast folgen. Bei manchen Sendungen hören über 10.000 Leute zu. Er erreicht vor allem Lehrer*innen, aber auch Follower*innen ihrer Gäste.
Mit dem Podcast zielt Nicole Schweiß auf eine Wechselwirkung: Sie holt die Perspektiven von Menschen, die etwas zum Thema Diskriminierung zu sagen haben, in das Feld der Schule. So erreicht sie, dass sich Lehrer*innen mit diesen Diskursen beschäftigen. Gleichzeitig bringt sie über die Reichweite der Gesprächspartner*innen Fragen aus dem Bereich der Schule in deren Kreise und trägt so zu einem gesellschaftlichen Bewusstsein dafür bei.
Stärkung und Vernetzung
Es gibt Rückmeldungen, dass sich Lehrer*innen und insbesondere junge Referendar*innen, aber auch Schüler*innen und Eltern durch eine Folge gestärkt fühlen, sich nicht mehr allein fühlen und auch konkrete Anregungen mitnehmen.
Der Podcast trägt dazu bei, ein informelles Bündnis zu schaffen. Konkret wird dieses Bündnis wirksam, wenn Nicole Schweiß mit den Menschen, die sich melden, Informationen und Ressourcen, wie zum Beispiel ein Musterschreiben für bestimmte Angelegenheiten, teilt.
So sieht sie als wesentlichen Effekt ihrer Arbeit auch den Austausch und das Netzwerk, das durch den Podcast entstanden ist – sowohl mit Kolleg*innen anderer Schulen als auch in die politische Bildung sowie die Kunst-, Kultur- und Literaturszene hinein.
Wirkung in die Schule
Diese ehrenamtliche Arbeit wirkt auf verschiedenen Ebenen in den Schulalltag hinein. Die Kolleg*innen und auch die Schulleitung hören Sendungen des Podcasts. In der Folge werden einzelne Podcastinhalte auch in der Schule diskutiert.
Nicole Schweiß leitet eine diskriminierungskritische AG an der Schule. In dieser Funktion kann sie ihre über „Kleine Pause“ entstandenen Netzwerke nutzen. Sie hat zum Beispiel an der Schule eine öffentliche Lesereihe mit prominenten Sprecher*innen organisiert. Diese Gäste hätte sie ohne ihre Verbindungen durch den Podcast nicht gewinnen können.
Gelingensfaktoren, Herausforderungen und Grenzen
Gelingensfaktoren
Der Erfolg des Podcasts basiert auf einer einfachen Idee. Der Podcast vergrößert die eigene Reichweite durch die Reichweite, die die Gesprächspartner*innen mitbringen.
Nicole Schweiß achtet als Gastgeberin des Podcasts darauf, dass die Gesprächspartner*innen und nicht sie selbst im Mittelpunkt des Austauschs stehen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie unsichtbar bleibt. Es ist ihr wichtig, ihre gesellschaftliche Positionierung als weiße Lehrerin als Ausgangspunkt zu nehmen und sie auch transparent zu kommunizieren. Dies wird dann wirksam, wenn Gäste, die nicht aus dem Schulsystem kommen, sehr explizite Forderungen an die Praxis in den Schulen stellen. An diesen Stellen bringt sie ihre pädagogische Professionalität und Erfahrung ein und vermittelt, was im aktuellen Bildungssystem umsetzbar ist und was nicht.
Herausforderungen und Grenzen
Transfer
Über den Podcast entstehen viele Ideen, wie sich Schule und Unterricht so verändern könnten, dass sie weniger Diskriminierung reproduzieren. Die Umsetzung dieser Impulse in die tagtägliche Praxis scheitert dann oft an den Rahmenbedingungen des Systems Schule.
Neutralitätsgebot
Auch wenn sie den Podcast in ihrer Freizeit betreibt, beschäftigt Nicole Schweiß das Neutralitätsgebot, wie es im Beutelsbacher Konsens für Schule und politische Bildung festgeschrieben ist. Politische Bildung soll demnach Menschen unterstützen, ihre eigene Meinung zu entwickeln, und sie nicht mit einer einseitigen Position „überwältigen“. Auch wenn dies so für eine aktivistische Arbeit wie den Podcast formell nicht relevant ist, wird sie doch als Host auch in ihrer Rolle als verbeamtete Lehrerin wahrgenommen. Sie möchte sich davon nicht einschränken lassen, umgeht keine Themen und lässt ihre Gesprächspartner*innen frei sprechen. Einzig bei Gästen mit parteipolitischen Interessen achtet sie darauf, dass diese nicht im Zentrum des Gesprächs stehen.
Barrierefreiheit
„Kleine Pause“ arbeitet daran, die Social-Media-Posts barrierearm zu gestalten. Bewusst liefert Nicole Schweiß in den sogenannten Shownotes, den Texten zu der jeweiligen Podcastfolgen, zusätzliche Informationen. Hier stößt sie aber an Grenzen, was für sie ehrenamtlich leistbar ist.
Tipps für die Übertragung
Gute Vorbereitung
Als die „Kleine Pause“-Macherinnen beschlossen hatten, einen Podcast aufzulegen, mussten sie sich zuerst über Kurse ein technisches Know-how aneignen und die entsprechende Ausrüstung anschaffen. Auch wenn die Ansprüche an einen solchen Podcast nicht so hoch sein müssen, sollten die Aufnahmen qualitativ doch hochwertig sein. Es soll Spaß machen zuzuhören. Es hat sich bewährt, hierfür die Unterstützung erfahrener Podcaster*innen einzuholen.
Das grundlegende technische Know-how ist schnell erlernbar. Inhaltlich erfordert die Arbeit an einem Podcast ein tiefes Fundament im Themenfeld. Laut der Überzeugung der „Kleine Pause“-Macherinnen reicht es nicht aus, einfach Expert*innen einzuladen. Die Hosts sollten – auch aus Gründen der Integrität gegenüber den Gästen – sich selbst im Themenfeld sehr gut auskennen.
Selbstreflexion
Die Idee für den Podcast war schnell gefunden, seine Weiterentwicklung aber kein Selbstläufer. Die beiden Gründerinnen Christina Schreck und Nicole Schweiß waren permanent miteinander und mit anderen im Austausch, holten regelmäßig Feedback ein und versuchten, das Format weiterzuentwickeln.
Risiko und Verantwortung
Über ein solches Format in die Öffentlichkeit zu gehen, erfordert immer wieder auch Mut. Die Hosts exponieren sich und gehen damit auch persönliche Risiken ein. Hier hilft es Nicole Schweiß, sich daran zu erinnern, aus welcher Position heraus sie diese Arbeit macht. Die Risiken von Menschen in unserer Gesellschaft, die selbst von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind und ihre Stimme erheben, sind noch viel größer.
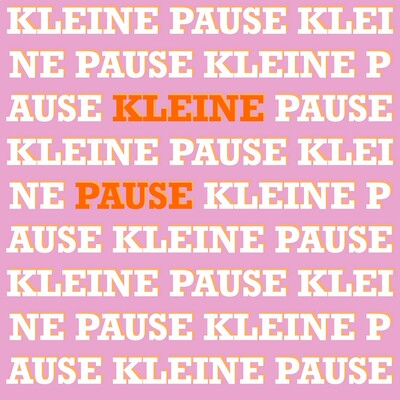
Weitere Informationen
-
Alle Folgen des Podcasts sind in den üblichen Portalen und Podcatchern abrufbar.
Gesammelt sind sie auch hier zu finden: https://kleinepause.podigee.io - Weitere Infos zum Projekt im Interview mit Paula Doering von der Literaturszene Köln
- Handreichung für einen diskriminierungskritischen und diversitätssensiblen Umgang mit der Revolution in Iran im Schulkontext, erschienen im Februar 2023 bei ufuq.de
